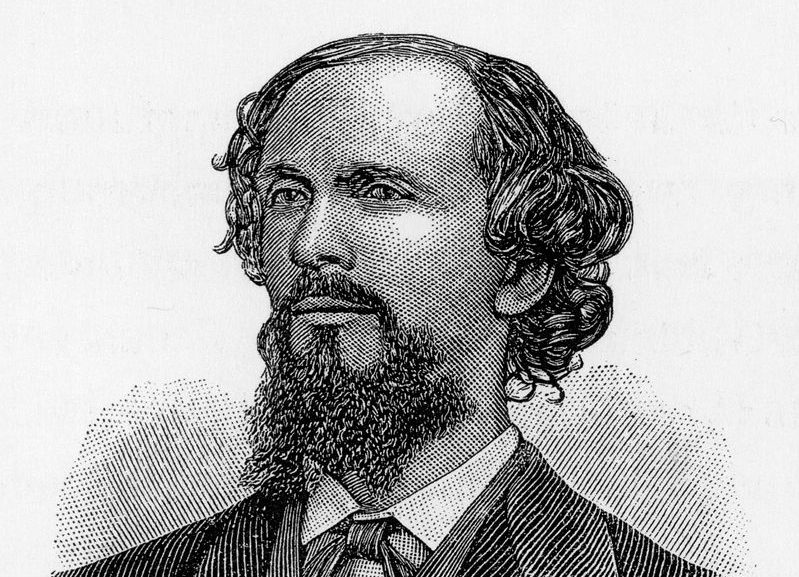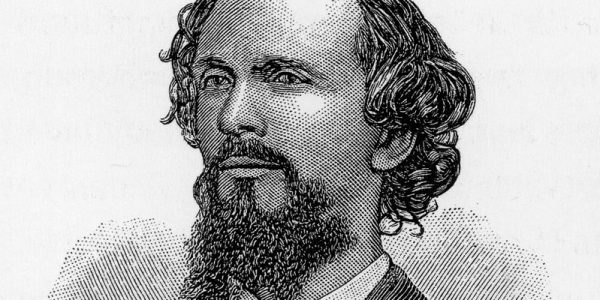
Karl Heinrich Ulrichs outete sich früh und plädierte für straffreie Homosexualität. Den »Schandparagrafen« 175 konnte der mutige Jurist nicht verhindern – nach der Einführung vor 150 Jahren ging er ins Exil.
Beim Deutschen Juristentag brauchte Karl Heinrich Ulrichs seinen ganzen Mut, als er am 29. August 1867 ans Rednerpult trat. Vor gut 500 Anwälten und Rechtsgelehrten forderte er im Münchner Konzerthaus Odeon: Man müsse das bestehende Strafrecht revidieren, um eine Gruppe unschuldiger Personen zu schützen und eine Welle von Selbsttötungen zu beenden. »Es handelt sich, meine Herren, um eine auch in Deutschland nach tausenden zählende Menschenclasse, um eine Menschenclasse, welche viele der größten und edelsten Geister unserer sowie fremder Nationen angehört haben…«
Bei den Zuhörern kam Unruhe auf, Ulrichs musste wiederholt ansetzen, weil Zwischenrufe ertönten: Schweigen solle er, fortfahren möge er. Mit Nachdruck sprach er weiter: »…welche Menschenclasse aus keinem andren Grunde einer strafrechtlichen Verfolgung, einer unverdienten, ausgesetzt ist als weil die räthselhaft waltende schaffende Natur ihr eine Geschlechtsnatur eingepflanzt hat, welche der allgemeinen gewöhnlichen entgegengesetzt ist…«
Weiter kam er nicht. Im Saal ging es jetzt wild durcheinander. Ulrichs musste seinen Vortrag unterbrechen und die Bühne verlassen.
Seine Sätze gelten als erstes öffentliches Coming-out der Geschichte. Karl Heinrich Ulrichs sprach sie 1867 in der Debatte darüber, ob die vom Königreich Preußen annektierten Gebiete die preußischen Strafrechtsbestimmungen übernehmen sollten. Damit würde Paragraf 143, der Homosexualität in Preußen seit 1851 unter Strafe stellte, auch auf liberalere deutsche Länder ausgedehnt werden.
Ulrichs forderte die Straffreiheit für gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern, die er als natürliche Veranlagung erklärte. Die Rede war der Höhepunkt seines Engagements gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Darauf war er bis an sein Lebensende stolz, wenngleich er scheiterte: Nachdem am 15. Mai 1871 das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich verkündet wurde und zum 1. Januar 1872 in Kraft trat, stellte Paragraf 175 »widernatürliche Unzucht« unter Strafe, mithin homosexuelle Handlungen unter Männern sowie von Menschen mit Tieren. Lesbische Liebe blieb davon unberührt.
»Karl, du bist nicht wie die anderen Jungen«
Stigmatisierung und Strafandrohung kannte Ulrichs, 1825 im ostfriesischen Aurich geboren, aus eigener Erfahrung. Schon der kleine Karl protestierte mit drei oder vier Jahren nach eigener Erinnerung gegen Jungskleidung und schwärmte noch vor dem zehnten Geburtstag für seinen Mitschüler Eduard. Oft habe seine Mutter geseufzt: »Karl, du bist nicht wie die anderen Jungen.«
1844 begann Ulrichs ein Rechtsstudium in Göttingen und wechselte nach fünf Semestern für ein Jahr nach Berlin. Die Stadt mit damals 400.000 Einwohnern bot »fruchtbaren Boden« für die »Rosen der Liebe«, wie er einem Freund schrieb. Obwohl Homosexualität in Preußen strafbar war, wurde sie in Berlin ausgelebt: Unter den Linden, der Tiergarten und ein kleines Wäldchen nahe der Neuen Wache waren Mitte des 19. Jahrhunderts polizeibekannte Orte für männliche Prostitution.
Kurz vor der Revolution 1848 kehrte Ulrichs ins Königreich Hannover zurück, trat in den Staatsdienst ein und stieg in Hildesheim bis zum Gerichtsassessor auf, zum Richter auf Probe. Doch 1854 reichte er seine Kündigung ein, nachdem Gerüchte über sein Privatleben kursierten: Ulrichs werde »häufig in Begleitung von Personen der niederen Klasse« gesehen. Ans Justizministerium wurde die Befürchtung reportiert, »dass Gerichtsassessor Ulrichs widernatürliche Wollust mit anderen Männern treibt«.
Hannover hatte das Strafrecht nach französischem Vorbild zwar liberalisiert und Homosexualität an sich nicht unter Strafe gestellt. Wurde sie aber als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung wahrgenommen, konnte sie dennoch verfolgt werden. Wegen dieser Gefahr beendete Ulrichs seine Justizkarriere.
Er schrieb als Journalist für die »Allgemeine Zeitung« und beschäftigte sich mit seiner Sexualität. Wissenschaftliche Erkenntnisse waren rar: Die Sexualwissenschaft entstand erst zur Jahrhundertwende. Männliche Homosexuelle wurden als »Päderasten« bezeichnet. Mediziner glaubten, man könne sie an Krankheiten wie »Abzehrung, Schwindsucht oder Wassersucht« erkennen. Der Berliner Arzt Johann Ludwig Casper formulierte als einer der ersten die These, dass Homosexualität angeboren sei und es sich um eine »geistige Zwitterbildung« handle.
Ermutigt von solchen Befunden offenbarte Ulrichs seiner Familie 1862 brieflich seine Homosexualität. Seine Schwester Luise drängte ihn, mit Gottes Hilfe an sich zu arbeiten. Ulrich erwiderte, sein Verlangen nach Männern könne nur sündig sein, wäre es pervers oder unnatürlich – beides bezweifelte er. Auch wenn seine Familie ihn nicht vollkommen verstand: Sie verstieß ihn nicht.
1864 veröffentlichte Ulrichs den ersten von zwölf Bänden der »Forschungen über die Räthsel der mannmännlichen Liebe«. Darin analysierte er die eigene Sexualität, zitierte aus wissenschaftlichen Arbeiten und entwickelte eine neue, vorurteilsfreie Terminologie für Homosexuelle: Als »Uranismus« bezeichnete er die gleichgeschlechtliche Liebe – nach der Göttin Aphrodite Urania, in Platons »Symposion« Tochter zweier männlicher Götter.
»Urning« nannte Ulrichs den schwulen Mann, »Urninde« die lesbische Frau und »Dioninge« heterosexuelle Menschen. Er vermutete bei Urningen eine weibliche Seele im Körper eines Mannes, die dazu führte, dass sie sich zu Männern hingezogen fühlten. Erst 1869 prägte der österreichisch-ungarische Schriftsteller Karl-Maria Kertbeny den heute gebräuchlichen Begriff der Homosexualität.
Anflüge eines Gemeinschaftsgefühls
Ulrichs Schriften schufen ein erstes Gemeinschaftsgefühl unter schwulen Männern. Aus ganz Deutschland erreichten ihn dankbare Briefe von Lesern, die erkannten, dass sie mit ihrer Sexualität nicht allein waren.
Mit dem Sieg Preußens über Österreich 1866 sollte die Strafverfolgung von Homosexualität auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Als Ulrichs protestierte, wurden seine Schriften beschlagnahmt, zensiert und verboten. Zweimal wurde er festgenommen und saß 1867 drei Monate in Festungshaft in Minden.
Die Stimmen für die Straffreiheit mehrten sich jedoch. Eine »Königlich wissenschaftliche Deputation für Medicinalwesen«, darunter der renommierte Berliner Arzt Rudolf Virchow, lehnte die Bestrafung »widernatürlicher Unzucht« in einem öffentlichen Gutachten im März 1869 ab. Selbst Preußens Justizminister Adolph Leonhardt erwog die Straffreiheit.
Doch dann wurde im Januar 1869 in Berlin der fünfjährige Emil Hanke vergewaltigt und verstümmelt aufgefunden. Unter großem öffentlichem Druck nahm die Berliner Polizei den Maler und Leutnant a.D. Karl Ernst von Zastrow fest, der sich offen zu seiner Homosexualität bekannte. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten Schriften von Ulrichs. Obwohl die Beweise für Zastrows Schuld fragwürdig waren, wurde er zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Abgeschafft erst nach 123 Jahren
Von straffreier Homosexualität war danach keine Rede mehr. Ab 1871 wurde »widernatürliche Unzucht« im ganzen Deutschen Reich mit einer Gefängnisstrafe von einem Tag bis zu fünf Jahren bestraft – ein schwerer Schlag für Ulrichs. Er veröffentlichte noch vier Bände seiner Schriftenreihe, bevor er 1880 ins Exil ging und sich in Italien niederließ. Sein Engagement als homosexueller Aktivist endete, fortan widmete Ulrichs sich Schreibprojekten in Latein und starb 1895 in L’Aquila.
Zwei Jahre später gründete der Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee. Diese erste Organisation zur Vertretung homosexueller Interessen trat für die Streichung von Paragraf 175 ein. Ihre Petitionen fanden 6000 Unterstützer, unter ihnen der SPD-Abgeordnete August Bebel.
Dennoch blieb der diskriminierende »Schwulenparagraf« noch lange im Strafrecht verankert und brachte viel Leid – insgesamt 123 Jahre lang. Die Nazis verschärften ihn und verfolgten damit systematisch Homosexuelle. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs übernahmen beide deutsche Staaten § 175 in ihre Strafgesetzbücher. In der DDR wurde er bereits 1968 faktisch außer Kraft gesetzt und 1989 ganz gestrichen, in der Bundesrepublik 1969 entschärft. Bis dahin wurden rund 50.000 Männer danach verurteilt. Im wiedervereinten Deutschland wurde der »175er« erst 1994 ersatzlos abgeschafft.
Die Grundlage für diesen späten Triumph legte ein anderer juristischer Pionier, der ein Jahrhundert nach Karl Heinrich Ulrichs ähnlich beherzt für die Rechte Homosexueller stritt: Manfred Bruns (1934-2019) – als Bundesanwalt hatte er jahrzehntelang einen Rechtsstaat vertreten, der seine eigene sexuelle Orientierung unter Strafe stellte.